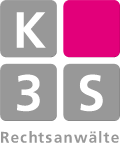Haben sich Ehegatten gegenseitig testamentarisch zunächst zum Alleinerben eingesetzt und für den Fall des „gemeinsamen Todes“ einen Schlusserben zum Alleinerben bestimmt, kann im Schlusserbfall die Alleinerbenstellung auch dann begründet sein, wenn die Ehegatten trotz der Bestimmung mehrere Jahre nach einander versterben.
In einem vom Kammergericht Berlin mit Beschluss vom 15.01.2020 entschiedenen Fall hatten sich Ehegatten im Jahr 1992 durch ein handschriftliches Testament zu gegenseitigen Erben eingesetzt. Für den Fall ihres „gemeinsamen Todes“ bestimmten sie das Patenkind des Ehemannes als Alleinerben. Der Ehemann verstarb im Jahr 2011, ca. 6 Jahre später verstarb die Ehefrau.
Das Patenkind des Ehemannes beantragte daraufhin einen Alleinerbschein, mehrere Geschwister der überlebenden Ehefrau beantragten ihrerseits einen Erbschein auf der Basis gesetzlicher Erbfolge mit der Begründung, die Eheleute seien im Abstand von vielen Jahren verstorben, weshalb das Testament keine Schlusserbeneinsetzung enthalte.
Die durchgeführte Beweisaufnahme hatte ergeben, dass die Eheleute als Testatoren mit dem „gemeinsamen“ Tod auch ein zeitversetztes Versterben gemeint hatten, weshalb die Anträge der Geschwister auf Erteilung eines Erbscheins zurückgewiesen worden waren. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb erfolglos.
Nach dem Kammergericht war eine Schlusserbeneinsetzung nicht ausdrücklich geregelt, weshalb das Testament nach §§ 133, 2084 BGB auszulegen war. Demnach ist entscheidend, was die Testatoren mit ihren Worten zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung ausdrücken wollten. Diese Auslegungsmaxime gibt vor, dass zunächst der Wortlaut des Testaments heranzuziehen ist. Der Begriff „gemeinsamer Tod“ ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht notwendig auf einen identischen Todeszeitpunkt oder selbst nur auf einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen beiden Todeszeitpunkten beschränkt. Er kann auf ein Ereignis hindeuten, das einen „gemeinsamen“ Zustand, nämlich den Tod beider Eheleute nach dem Versterben des zweiten Ehepartners, beschreibt. Gemeint sei somit eine Erbeinsetzung für den Fall, dass beide Eheleute „gemeinsam tot“, also sind beide tot sind.
Die Zeugenaussagen in der Beweisaufnahme ergaben eine enge persönliche Verbundenheit der Erblasserin, der Ehefrau, mit dem Patenkind ihres Ehemannes. Der Erblasserwille ist nach § 2247 formgerecht im Testament angedeutet, denn die Worte „gemeinsamer Tod“ sind schon nach dem allgemeinen Sprachverständnis nicht darauf beschränkt, zwei zeitlich zusammenfassende Ereignisse, also dem gleichzeitigen Tod beider Testatoren zur selben „juristischen Sekunde“, zu bezeichnen.
Der vom Kammergericht Berlin entschiedene Fall zeigt deutlich, dass es mannigfaltige Auslegungsprobleme bei der häufig von Ehegatten gewünschten Regelung für den Fall des „gemeinsamen“ oder „gleichzeitigen“ Versterbens geben kann. Bei einer ungenauen Ausdrucksweise im Testament ist dieses auszulegen und der tatsächliche Will des oder der Erblasser zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung zu ermitteln. Es empfiehlt sich, den Begriff des gemeinsamen oder gleichzeitigen Versterbens zeitlich zu definieren, etwa dahingehend wer erben soll, wenn beide Ehegatten innerhalb eines Kalenderjahres oder in einem Zeitraum von einem Jahr versterben sollten.